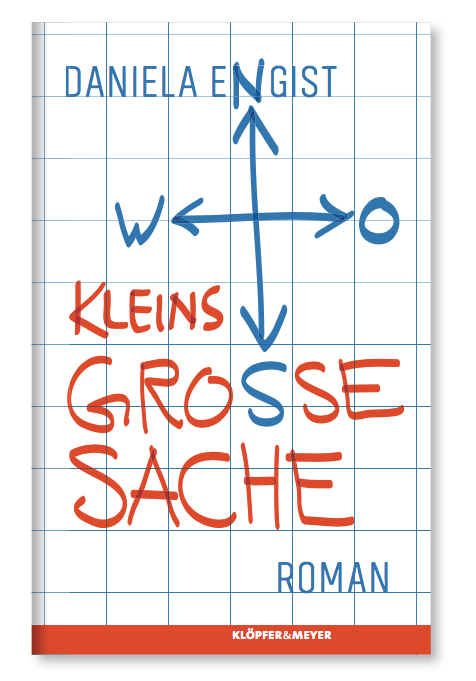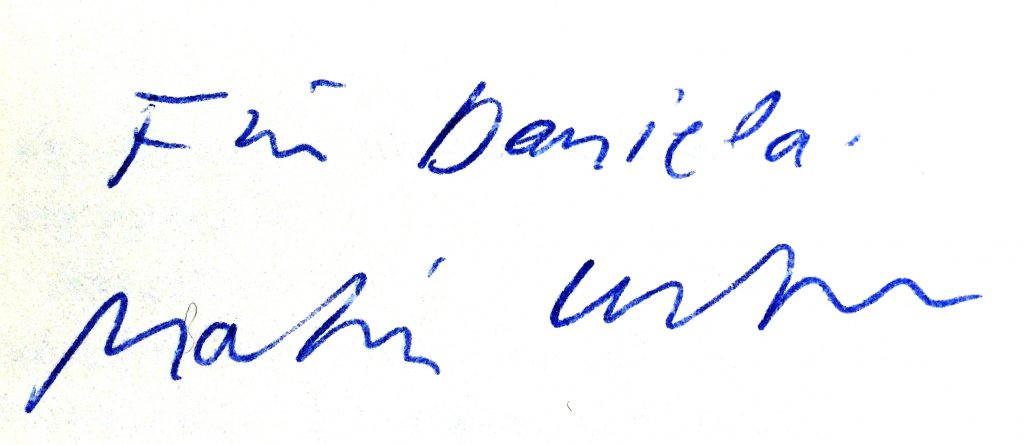Die am häufigsten gestellte Frage an eine Autorin ist nicht etwa die nach dem autobiografischen Anteil des Werks oder ob dies oder das tatsächlich so oder so ähnlich gewesen sei und schon gar nicht die nach einem wie auch immer gearteten ästhetischen oder poetischen Programm, sondern: „Wie lange haben Sie an dem Buch geschrieben?“ Diese Frage kehrt mit einer äußerst zuverlässigen mich inzwischen nicht mehr überraschenden aber noch immer irritierenden Hartnäckigkeit wieder. Neue Lesung, neue Gesichter, alte Frage. Nun gut, es ist ein recht dickes Buch. Da kann man sich schonmal fragen, wie lange … Die Antwort habe ich unterdessen als Mitternachtswissen parat: einundzwanzig Monate, halbtags von neun bis dreizehn Uhr. Ich habe nämlich recherchiert.
Seit kurzem aber – das Ganze setzte so etwa drei Monate nach dem Buchhandlungsauslieferungstermin ein –, scheint sich jeder vor allem für eines brennend zu interessieren: „Wie läuft’s?“
Urs Huber würde natürlich augenzwinkernd, zahnfleischlächelnd und im Staccatoschritt vorbeieilend sagen: „Geht’s gut?“
Jetzt könnte man darauf eine ganze Reihe von möglichen Antworten geben, je nachdem auf was diese kleine, harmlos formulierte Frage so alles abzielt:
Kaufen Menschen das Buch? Kaufen viele Menschen das Buch? Wie finden die Menschen das Buch? Reden Menschen über das Buch? Wird das Buch besprochen? Wird das Buch gut besprochen? Machst du Lesungen? Machst du viele Lesungen? Wie ist die Resonanz bei den Lesungen? Ist der Verlag zufrieden? Bist du zufrieden?
Fühlt sich ein bisschen an wie Quartalsbericht: In einem insgesamt rückläufigen Markt haben sich die Verkaufszahlen des neu eingeführte Produkts im Vergleich zum Vorjahreszeitraum signifikant verbessert. Haha.